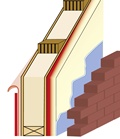Hausbau / Fertighaus: Die Sanierung älterer Fertighäuser ist auf alle Fälle eine Sache für den Fachmann: Der hessische Bauzulieferer INTHERMO verfügt über das erforderliche Fachwissen und führt zahlreiche Spezialprodukte in seinem Lieferprogramm, mit denen gelernte Zimmerleute und versierte Bauhandwerker aus einem betagten Fertighaus in Holztafelbauweise wieder ein liebenswertes Schmuckstück machen können. Dazu zählt unter anderem Kairatin, ein hochwirksames Vlies auf Schafwollbasis, das sogar die Raumluftqualität verbessern kann.
Weiterlesen
 Heiztechnik / Heizen und Lüften: Um steigenden energetischen Anforderungen zu genügen, sind Gebäudehüllen heute praktisch luftdicht ausgelegt. Im Neubau, aber auch in der Sanierung lassen sich Heizwärme-Verluste so auf ein Minimum reduzieren. Ein natürlicher Luftaustausch, der früher über Fugen und Ritzen erfolgte, wird dabei allerdings ebenfalls unterbunden. So kann ein Raumklima entstehen, das für Bewohner und Bausubstanz ungesund ist. Zuverlässige Abhilfe schafft eine kontrollierte Wohnungslüftung.
Heiztechnik / Heizen und Lüften: Um steigenden energetischen Anforderungen zu genügen, sind Gebäudehüllen heute praktisch luftdicht ausgelegt. Im Neubau, aber auch in der Sanierung lassen sich Heizwärme-Verluste so auf ein Minimum reduzieren. Ein natürlicher Luftaustausch, der früher über Fugen und Ritzen erfolgte, wird dabei allerdings ebenfalls unterbunden. So kann ein Raumklima entstehen, das für Bewohner und Bausubstanz ungesund ist. Zuverlässige Abhilfe schafft eine kontrollierte Wohnungslüftung.