 Energie / Energiepolitik: Die Bedeutung von Energiespeichern wird im Rahmen der Energiewende weiter zunehmen, nicht zuletzt weil diese als Flexibilitätsoption die Netzintegration der Erneuerbaren Energien erleichtern. Nennenswerte zusätzliche Kapazitäten, vor allem Langzeitspeicher wie Power-to-Gas-Anlagen, rechnen sich jedoch nur ab einem Anteil an Erneuerbaren von 60 Prozent, dennoch haben Siemens, RWE und E.ON kürzlich erste eigene Anlagen eröffnet. Gleichzeitig gibt es, bedingt durch die sinkenden Preise für die Lithium-Ionen-Technologie, in letzter Zeit immer mehr Batteriespeicher-Projekte.
Energie / Energiepolitik: Die Bedeutung von Energiespeichern wird im Rahmen der Energiewende weiter zunehmen, nicht zuletzt weil diese als Flexibilitätsoption die Netzintegration der Erneuerbaren Energien erleichtern. Nennenswerte zusätzliche Kapazitäten, vor allem Langzeitspeicher wie Power-to-Gas-Anlagen, rechnen sich jedoch nur ab einem Anteil an Erneuerbaren von 60 Prozent, dennoch haben Siemens, RWE und E.ON kürzlich erste eigene Anlagen eröffnet. Gleichzeitig gibt es, bedingt durch die sinkenden Preise für die Lithium-Ionen-Technologie, in letzter Zeit immer mehr Batteriespeicher-Projekte.
Weiterlesen
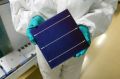 Energie / Energiepolitik: Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und Energieexperten zahlreicher wissenschaftlicher Einrichtungen warnen vor einem unnötigen Gegeneinander von Effizienztechnologien und Erneuerbaren Energien. Die Nutzung von Gaskraftwerken sei zwar noch für einige Zeit notwendig und sinnvoll, wenn diese in Kraft-Wärme-Kopplung besonders effizient betrieben werden. Die Förderung fossil erzeugter Fernwärme müsse bei Neuinvestitionen aber auf die Heizperiode beschränkt werden.
Energie / Energiepolitik: Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und Energieexperten zahlreicher wissenschaftlicher Einrichtungen warnen vor einem unnötigen Gegeneinander von Effizienztechnologien und Erneuerbaren Energien. Die Nutzung von Gaskraftwerken sei zwar noch für einige Zeit notwendig und sinnvoll, wenn diese in Kraft-Wärme-Kopplung besonders effizient betrieben werden. Die Förderung fossil erzeugter Fernwärme müsse bei Neuinvestitionen aber auf die Heizperiode beschränkt werden.

 Energie / Energiepolitik: Die Bedeutung von Energiespeichern wird im Rahmen der Energiewende weiter zunehmen, nicht zuletzt weil diese als Flexibilitätsoption die Netzintegration der Erneuerbaren Energien erleichtern. Nennenswerte zusätzliche Kapazitäten, vor allem Langzeitspeicher wie Power-to-Gas-Anlagen, rechnen sich jedoch nur ab einem Anteil an Erneuerbaren von 60 Prozent, dennoch haben Siemens, RWE und E.ON kürzlich erste eigene Anlagen eröffnet. Gleichzeitig gibt es, bedingt durch die sinkenden Preise für die Lithium-Ionen-Technologie, in letzter Zeit immer mehr Batteriespeicher-Projekte.
Energie / Energiepolitik: Die Bedeutung von Energiespeichern wird im Rahmen der Energiewende weiter zunehmen, nicht zuletzt weil diese als Flexibilitätsoption die Netzintegration der Erneuerbaren Energien erleichtern. Nennenswerte zusätzliche Kapazitäten, vor allem Langzeitspeicher wie Power-to-Gas-Anlagen, rechnen sich jedoch nur ab einem Anteil an Erneuerbaren von 60 Prozent, dennoch haben Siemens, RWE und E.ON kürzlich erste eigene Anlagen eröffnet. Gleichzeitig gibt es, bedingt durch die sinkenden Preise für die Lithium-Ionen-Technologie, in letzter Zeit immer mehr Batteriespeicher-Projekte. Energie / Energiepolitik: Mit neuen Informationsangeboten zu modernen Heizungs-, Ofen- und Schornsteinsystemen sowie aktuellen Fördermitteln richtet sich die Allianz Freie Wärme auf ihrer Website an Bauherren, Politiker sowie Fachleute vom Bau, die beim Hausbau oder bei einer Heizungsmodernisierung mit der Wahl ihrer Heizungstechnik und Energieträger unabhängig bleiben wollen.
Energie / Energiepolitik: Mit neuen Informationsangeboten zu modernen Heizungs-, Ofen- und Schornsteinsystemen sowie aktuellen Fördermitteln richtet sich die Allianz Freie Wärme auf ihrer Website an Bauherren, Politiker sowie Fachleute vom Bau, die beim Hausbau oder bei einer Heizungsmodernisierung mit der Wahl ihrer Heizungstechnik und Energieträger unabhängig bleiben wollen.
 Energie / Energiepolitik: „Der BEE begrüßt nachdrücklich die Entscheidungen der Koalition zum Strommarkt, bedauert aber die halbherzigen Schritte zum Klimaschutz. Der Verzicht auf die Einführung von Kapazitätsmärkten ist eine ebenso richtige Entscheidung wie die Weiterentwicklung der Strommärkte. Der Verzicht auf den Klimabeitrag widerspricht allerdings dem Verursacherprinzip und führt zu unnötigen Mehrkosten“, sagt Dr. Hermann Falk, Geschäftsführer des Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE).
Energie / Energiepolitik: „Der BEE begrüßt nachdrücklich die Entscheidungen der Koalition zum Strommarkt, bedauert aber die halbherzigen Schritte zum Klimaschutz. Der Verzicht auf die Einführung von Kapazitätsmärkten ist eine ebenso richtige Entscheidung wie die Weiterentwicklung der Strommärkte. Der Verzicht auf den Klimabeitrag widerspricht allerdings dem Verursacherprinzip und führt zu unnötigen Mehrkosten“, sagt Dr. Hermann Falk, Geschäftsführer des Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE).
 Energie / Energiepolitik: Die Energiewende ist in vollem Gange. Die Politik hat sich zum Ziel gesetzt, dass in 35 Jahren 80 Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen kommen sollen. Aber auch Privathaushalte können einen Beitrag zur Energiewende leisten, etwa mit einer Hybridheizung, die auf verschiedene Energien setzt.
Energie / Energiepolitik: Die Energiewende ist in vollem Gange. Die Politik hat sich zum Ziel gesetzt, dass in 35 Jahren 80 Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen kommen sollen. Aber auch Privathaushalte können einen Beitrag zur Energiewende leisten, etwa mit einer Hybridheizung, die auf verschiedene Energien setzt.
 Energie / Energiepolitik: Eine große Mehrheit der Bundesbürger stärkt Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Gabriel den Rücken bei ihren Klimaschutzplänen. 70 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollte, um das deutsche Klimaschutzziel von 40 Prozent Emissionsminderung bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Dies geht aus einer repräsentativen TNS Emnid Umfrage unter 1002 Bundesbürgern im Auftrag der Bürgerbewegung Campact und der Umweltschutzorganisation WWF hervor.
Energie / Energiepolitik: Eine große Mehrheit der Bundesbürger stärkt Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Gabriel den Rücken bei ihren Klimaschutzplänen. 70 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollte, um das deutsche Klimaschutzziel von 40 Prozent Emissionsminderung bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Dies geht aus einer repräsentativen TNS Emnid Umfrage unter 1002 Bundesbürgern im Auftrag der Bürgerbewegung Campact und der Umweltschutzorganisation WWF hervor.
 Energie / Energiepolitik: Ein Bündnis mehrerer Energieversorger und Verbände fordert die Bundesregierung auf, ein alternatives Direktvermarktungsmodell für Ökostrom endlich zu ermöglichen. "Minister Gabriel hat ein Dreivierteljahr nach der jüngsten EEG-Reform noch immer nicht die dort vorgesehene Verordnung für ein Marktmodell erlassen, das es Verbrauchern ermöglicht, direkt Ökostrom aus konkreten Anlagen zu beziehen", erklärten die Unternehmen Clean Energy Sourcing, EWS Schönau, Greenpeace Energy, MVV Energie AG und Naturstrom AG in Berlin.
Energie / Energiepolitik: Ein Bündnis mehrerer Energieversorger und Verbände fordert die Bundesregierung auf, ein alternatives Direktvermarktungsmodell für Ökostrom endlich zu ermöglichen. "Minister Gabriel hat ein Dreivierteljahr nach der jüngsten EEG-Reform noch immer nicht die dort vorgesehene Verordnung für ein Marktmodell erlassen, das es Verbrauchern ermöglicht, direkt Ökostrom aus konkreten Anlagen zu beziehen", erklärten die Unternehmen Clean Energy Sourcing, EWS Schönau, Greenpeace Energy, MVV Energie AG und Naturstrom AG in Berlin.
 Energie / Energiepolitik: Die Transformation der Energieversorgung hin zu einem klimafreundlichen, risikoarmen, zuverlässigen und bezahlbaren Energiesystem ist eine notwendige globale Aufgabe. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Versorgung durchläuft das Energiesystem verschiedene Phasen und muss sich dabei technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Dieser durchgreifende Veränderungsprozess umfasst den Umbau der Infrastrukturen für die Erzeugung, Verteilung, Wandlung, Speicherung von Strom, Wärme und Kraftstoffen sowie deren effiziente Nutzung.
Energie / Energiepolitik: Die Transformation der Energieversorgung hin zu einem klimafreundlichen, risikoarmen, zuverlässigen und bezahlbaren Energiesystem ist eine notwendige globale Aufgabe. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Versorgung durchläuft das Energiesystem verschiedene Phasen und muss sich dabei technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Dieser durchgreifende Veränderungsprozess umfasst den Umbau der Infrastrukturen für die Erzeugung, Verteilung, Wandlung, Speicherung von Strom, Wärme und Kraftstoffen sowie deren effiziente Nutzung.