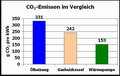ROTEX ist Ready for BioOil
 ROTEX Öl-Brennwertkessel und Heizöltanks sind für Bioöl vorbereitet
ROTEX Öl-Brennwertkessel und Heizöltanks sind für Bioöl vorbereitet
Heiztechnik / Heizkessel: ROTEX ist „Ready for BioOil“! Mit einem speziellen Logo bestätigt der führende Hersteller von Öl-Brennwertkesseln in Deutschland die Bioöl-Verträglichkeit seines kompletten Ölheizungssystems. Die ROTEX A1 Öl-Brennwertkessel, variosafe Sicherheitsöltanks und die Öl-Förderleitung ROTEX VA-Oil sind heute schon für den Betrieb von Heizöl mit regenerativen Bioölanteilen vorbereitet.